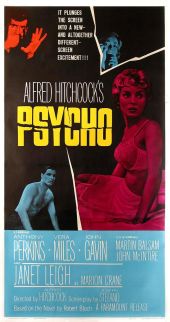Vorortidylle, wirtschaftlicher Aufschwung, glückliche Familien, Sauberkeit und Ordnung, der lächelnde Milchmann. der jeden Morgen seinem Job nachgeht… das offizielle, auf hochglanzpolierte Bild der US-amerikanischen 50er Jahre ist an Biederkeit und Hochmut kaum zu überbieten und zudem durch Hollywood so stark verbreitet worden, dass es bis heute gern als Zielscheibe von Kritik und Spott genutzt wird oder Grund für Nostalgie und Unbehagen bietet. „Pleasantville“ in seiner modernen Biederkeit bezieht sich genauso darauf wie jeder zweite Lynch-Film. Aber auch schon kontemporäre Filme kratzten am Bild der sauberen 50er, aber niemand so radikal und mit solch ätzendem Spott wie Samuel Fuller. In der ersten Hälfte der 60er, als diese Epoche der Sauberkeit genau genommen noch nicht von den um sich greifenden Gegenbewegungen beendet wurde, machte er zwei Filme die wie sein filmisches Vermächtnis wirken können. Die Genregrenzen, in denen Sich Fuller bis dahin bewegte, lies er hinter sich und Themen, die er früher nur angedeutet hatte, formulierte er in Shock Corridor und The Naked Kiss voll aus. Doch dafür musste er bezahlen und konnte in 15 Jahren keine Filme mehr in Hollywood realisieren, denn er wollte mit diesen Filmen nichts geringeres als die Maske von Sauberkeit, nationaler Einheit und Überlegenheit einem korrumpierten, heuchlerischen Land vom Gesicht zu reißen… zu einer Zeit als das noch keine Selbstverständlichkeit war.
Vorortidylle, wirtschaftlicher Aufschwung, glückliche Familien, Sauberkeit und Ordnung, der lächelnde Milchmann. der jeden Morgen seinem Job nachgeht… das offizielle, auf hochglanzpolierte Bild der US-amerikanischen 50er Jahre ist an Biederkeit und Hochmut kaum zu überbieten und zudem durch Hollywood so stark verbreitet worden, dass es bis heute gern als Zielscheibe von Kritik und Spott genutzt wird oder Grund für Nostalgie und Unbehagen bietet. „Pleasantville“ in seiner modernen Biederkeit bezieht sich genauso darauf wie jeder zweite Lynch-Film. Aber auch schon kontemporäre Filme kratzten am Bild der sauberen 50er, aber niemand so radikal und mit solch ätzendem Spott wie Samuel Fuller. In der ersten Hälfte der 60er, als diese Epoche der Sauberkeit genau genommen noch nicht von den um sich greifenden Gegenbewegungen beendet wurde, machte er zwei Filme die wie sein filmisches Vermächtnis wirken können. Die Genregrenzen, in denen Sich Fuller bis dahin bewegte, lies er hinter sich und Themen, die er früher nur angedeutet hatte, formulierte er in Shock Corridor und The Naked Kiss voll aus. Doch dafür musste er bezahlen und konnte in 15 Jahren keine Filme mehr in Hollywood realisieren, denn er wollte mit diesen Filmen nichts geringeres als die Maske von Sauberkeit, nationaler Einheit und Überlegenheit einem korrumpierten, heuchlerischen Land vom Gesicht zu reißen… zu einer Zeit als das noch keine Selbstverständlichkeit war.
 Schauen wir uns als erstes Shock Corridor an, einem der offiziellen Meisterwerke Fullers. Auf den ersten Blick ist das kaum zu glauben. Ein Film von erhabener Trashigkeit, Vorhersehbarkeit und mit einem unfassbaren Ausmaß an Klischees. Der Plot lässt das Ausmaß schon erkennen: Reporter Johnny Barrett (gespielt von Peter Breck, vielleicht noch am ehesten bekannt aus “The Crawling Hand”) lässt sich in eine Nervenheilanstalt einschleusen, um einen Mord aufzuklären… den Pulitzer-Preis fest im Blick. Ein gewisser Sloan wurde umgebracht und drei Insassen waren Zeugen. Doch alle drei haben den Kontakt zur Realität verloren. Illustre Gestalten sind es, denen Barrett das Geheimnis entreißen muss: ein Kriegsveteran, der sich für Jeb Stuart, General der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, hält, ein Afroamerikaner, welcher glaubt der Gründer des Ku-Klux-Klans zu sein, und ein Atomraketeningenieur, der sich wie ein sechsjähriges Kind benimmt. Barrett täuscht Inzestgelüste und Haarfetischismus (sic!) vor, um in die Nervenanstalt zu gelangen. Im Kampf um das Geheimnis der drei Zeugen steht aber zunehmend seine eigene geistige Gesundheit auf dem Spiel.
Schauen wir uns als erstes Shock Corridor an, einem der offiziellen Meisterwerke Fullers. Auf den ersten Blick ist das kaum zu glauben. Ein Film von erhabener Trashigkeit, Vorhersehbarkeit und mit einem unfassbaren Ausmaß an Klischees. Der Plot lässt das Ausmaß schon erkennen: Reporter Johnny Barrett (gespielt von Peter Breck, vielleicht noch am ehesten bekannt aus “The Crawling Hand”) lässt sich in eine Nervenheilanstalt einschleusen, um einen Mord aufzuklären… den Pulitzer-Preis fest im Blick. Ein gewisser Sloan wurde umgebracht und drei Insassen waren Zeugen. Doch alle drei haben den Kontakt zur Realität verloren. Illustre Gestalten sind es, denen Barrett das Geheimnis entreißen muss: ein Kriegsveteran, der sich für Jeb Stuart, General der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, hält, ein Afroamerikaner, welcher glaubt der Gründer des Ku-Klux-Klans zu sein, und ein Atomraketeningenieur, der sich wie ein sechsjähriges Kind benimmt. Barrett täuscht Inzestgelüste und Haarfetischismus (sic!) vor, um in die Nervenanstalt zu gelangen. Im Kampf um das Geheimnis der drei Zeugen steht aber zunehmend seine eigene geistige Gesundheit auf dem Spiel.
Plakativ führt der Film durch die Anstalt… durch den Shock Corridor. Hölzerne Dialoge, fadenscheinige Traumsequenzen und aufdringliche innere Monologe nötigen die Antriebskräfte der Figuren dem Zuschauer auf. Barrett und seine Lebensgefährtin tragen ihre Psychologie auf der Zunge spazieren. Die Schauspieler übertreiben jedes Gefühl so, dass James Dean und Emil Jannings wie dezente Schauspieler erscheinen. Die Insassen der Anstalt sind so inszeniert, dass auch der Letzte im Publikum nach zwei Sekunden versteht, dass diese Menschen verrückt sind. Kein (Hollywood-)Klischee wird ausgelassen. Sie sind hysterisch, schreien, handeln absonderlich (nachts Arien singen, auf dem trockenen und ohne Boot rudern usf.) und lachen, als ob sie die Welt bald unterwerfen. Das Ende des Films hält auch keine Überraschungen bereit, zu deutlich war der Plot des Films konstruiert. Das einzig Gute scheint erst einmal die schwarz-weiß Photographie von Stanley Cortez zu sein, die wuchtige und wundervolle Bilder erschafft, die sich einem in den Kopf brennen. In diesen Bildern finden sich auch mal weniger aufdringliche Andeutungen wie ein schief hängendes Bild von Freud im Büro des Klinikdirektors.
Und doch ist “Shock Corridor” reizvoll und vielleicht sogar ein großer Film. Denn die Momente in denen Barrett mit den drei Insassen redet, sind wie Schocks. Es sind Momente in denen Fuller plötzlich eine nicht mehr erwartete Eindringlichkeit entwickelt. Plötzlich reden Menschen, wirkliche Menschen. Plötzlich werden unter all den Oberflächlichkeiten persönliche Schicksale und Aussagen bemerkbar. Plötzlich verlässt der Film die Klischees seiner Inszenierung und entwickelt eine betörende Kraft. Es sind diese Momente die klar machen, dass dieser Film nicht realistisch sein möchte. Die USA werden zu einer Irrenanstalt stilisiert… beherrscht vom Wahn der Kommunistenjagd, des Rassismus, des Militarismus und einer verbissenen Erfolgsgeilheit. Jeder der drei hat eine dieser Ideologien so hart am eigenen Leib zu spüren bekommen, dass sie nur noch den Ausweg der Realitätsverdrängung nehmen konnten.
Kurze Phasen der Klarsicht, die sie haben, werden von Träumen eingeleitet. Doch diese Träume sind nicht die überdeutlichen Barretts, die durch die Propaganda von Wort und Bild beherrscht werden, sondern farbige, verzerrte, undeutliche Sequenzen von Subjektivität. Die folgenden Mono-/Dialoge sind auch nicht die psychologisierenden, festlegenden Dialoge des restlichen Films. Es sind Dialoge, die hinter der Fassade der Worte auch das Unbekannte einer Seele erahnen lassen. Der Wahn Hollywoods wird verlassen. Doch Barrett erkennt diese Phasen nicht, er will sie nur ausnutzen um an sein Ziel zu gelangen. Und so bleibt er blind dafür, dass er schon längst selbst mitten im Kampf um seine eigene geistige Gesundheit steckt.
 “Shock Corridor” greift so eine Realität an, die ihre Augen vor den eigenen Problemen schließen möchte. Die sich in Wahnvorstellungen rettet und so die Probleme nur vermehrt. Doch “Shock Corridor” konnte Hollywood Fuller noch verzeihen, da der Film mit Verrückten und Ausgeschlossenen überfüllt ist. Die Anklage konnte auf diese und den Pulp geschoben werden. Was Fuller aber mit The Naked Kiss auf die Leinwand brachte, war ein roher, subversiver Schlag ins Gesicht der amerikanischen Kleinstadt, des Symbols von Anstand und Amerikas kultureller Überlegenheit. Das perfideste daran ist aber vor allem die Machart… das an Sarkasmus kaum zu überbietende Lachen ins Gesicht der Heuchelei.
“Shock Corridor” greift so eine Realität an, die ihre Augen vor den eigenen Problemen schließen möchte. Die sich in Wahnvorstellungen rettet und so die Probleme nur vermehrt. Doch “Shock Corridor” konnte Hollywood Fuller noch verzeihen, da der Film mit Verrückten und Ausgeschlossenen überfüllt ist. Die Anklage konnte auf diese und den Pulp geschoben werden. Was Fuller aber mit The Naked Kiss auf die Leinwand brachte, war ein roher, subversiver Schlag ins Gesicht der amerikanischen Kleinstadt, des Symbols von Anstand und Amerikas kultureller Überlegenheit. Das perfideste daran ist aber vor allem die Machart… das an Sarkasmus kaum zu überbietende Lachen ins Gesicht der Heuchelei.
Der Film beginnt furios. Von wilder Jazzmusik unterlegt zeigen rohe, hektische Bilder wie Kelly (gespielt von Constance Towers, in “Shock Corridor” Barretts Lebensgefährtin) einen Mann verprügelt und sich 75 Dollar von ihm nimmt, die er ihr schuldet. Der Vorspann folgt. Die darauf folgende Handlung hat einen deutlich ruhigeren Ton. Kelly kommt mit einem Bus in die Kleinstadt Grantville und ist von der Idylle wie verzaubert. Sie schläft mit dem Sheriff, aber das wird ihr letzter Job als Prostituierte sein. Die Magie des Glücks und des Anstands machen ihr klar, dass sie sich ändern will. Sie wird Kinderkrankenschwester, verliebt sich in einen reichen, gebildeten Mann, der sie heiraten möchte und baut sich eine glückliche Existenz auf. Der Kitsch übernimmt zusehends den Film. Plot, Bildsprache und Musik lassen “The Naked Kiss” das Bild einer Soap Opera annehmen… einer Soap Opera, in der sich alle Probleme in Wohlgefallen auflösen. Doch all das wird wie ein Bumerang zurück kommen und von Fuller ad absurdum geführt.
Wer sich schon sicher ist, dass er den Film sehen möchte, sollte diesen Absatz wahrscheinlich nicht weiter lesen, da das, was folgt ein Erlebnis ist, dass man selbst machen sollte. Doch ich muss schreiben, obwohl ich schweigen sollte: Alles scheint sich in Perfektion aufzulösen. Man weiß, dass irgendwas passieren muss, schließlich ist man in einem Samuel Fuller Film. Jede Überlegung, wo der Haken liegen könnte, läuft ins Leere. Die Soap-Opera-Vorstellung einer perfekten Welt scheint wahr geworden. Unerträglich ist das Glück und gerade als man zu überlegen beginnt, wie radikal es wäre einen Film in dieser Perfektion enden zu lassen, schlägt Fuller zu. Unerbittlich. Sekunden bevor der Zuschauer sicher erkennt, was der Haken ist, lässt er im Publikum einen Verdacht keimen. In einer perfide umgesetzten Wendung nimmt er den Traum des Glückes selbst, in Form eines Kinderliedes, und verwandelt dieses in den Abgesang auf die perfekte Welt. Kelly fällt in einen unsagbaren Abgrund und zieht jeden, der zusieht, mit. Es ist der naked kiss, der Kuss der Perversion und Samuel Fuller gibt uns diesen Kuss, der uns erfahren lässt, wie verkommen es hinter dem Schein der Kleinstadt, der USA aussieht. Ein Meisterwerk.